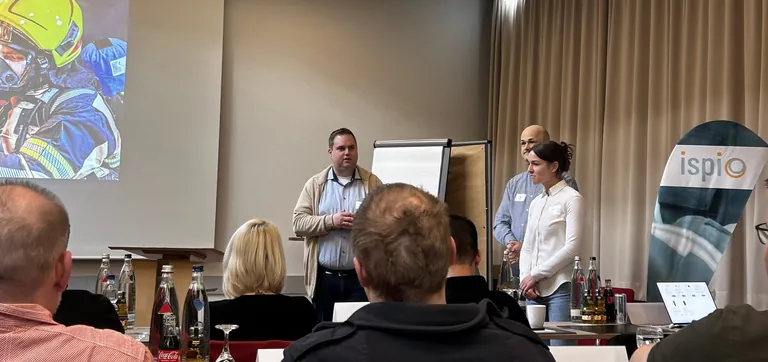Dass Schutzkleidung uneingeschränkt funktionieren muss, ist eigentlich klar. Dennoch befindet sich bei Feuerwehr und Rettungsdienst immer wieder PSA mit Schäden. Um dies zu vermeiden, muss man die komplexe Materie kennen: von der Entstehung, Erkennung und Einstufung von Schäden bis hin zu gesetzlichen Vorgaben.
Zu einem Workshop der ISPI (Interessenverband für sachgerechte Pflege und Instandhaltung von PSA e.V.) kamen Anfang März 2024 mehr als 50 Interessierte aus ganz Deutschland nach Düsseldorf ins Hotel Leonardo Royal Königsallee, um sich in Theorie und Praxis weiterzubilden.
Der Teilnehmerkreis bestand neben Mitarbeitenden aus dem Bereich der PSA-Beschaffung von sogenannten BOS (also Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, zu denen Feuerwehren und Rettungsdienste gehören) aus Mitarbeitenden der entsprechenden Bekleidungskammern und Dienstleistern in der Aufbereitung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).
ISPI-Workshop: Technische Normen
Nach den Grußworten der Vertreter des Interessenverbandes Philip Plümper, Agnes Schmitz und Axel Ratz wurde der erste Workshop-Tag mit einem Vortrag von Timo Schäfer eingeleitet. Quasi in Dreifachfunktion, als Assistent der Geschäftsleitung bei der Schäfer Mietwäsche Service GmbH, als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort sowie als geprüfte Fachkraft für PSA, referierte er über wichtige Gesetze und technische Normen. "Minimale Schäden an PSA können maximale Auswirkungen haben", so Schäfer. PSA dient dem Schutz von Leib und Leben und folglich zieht der Umgang damit eine hohe Verantwortung mit sich.
Minimale Schäden an PSA können maximale Auswirkungen haben.
Timo Schäfer
Er führte u.a. aus, wie PSA richtig gekennzeichnet sein muss, weshalb keine Feuerwehr um eine regelmäßige Überprüfung ihrer PSA herumkommt und nach welchen Prüfgrundsätzen diese durchzuführen ist. Die Beachtung der Anforderungen gemäß der PSA-Verordnung (PSA-VO), der PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) sowie der Grundsätze der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) spielen dabei eine wichtige Rolle.
Wenn das CE-Zeichen unleserlich ist
Im Hinblick auf das Hauptthema des Workshops, die Schadenserkennung, gab Schäfer auch bereits einige Beispielen inklusive der sich aus den gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften ergebenden Folgen. So wurde erwähnt, dass eine PSA nicht nur, wenn sie Funktionseinschränkungen aufweist aus dem Verkehr zu ziehen ist, sondern auch, wenn die Kennzeichnung, wie beispielsweise das CE-Zeichen, unleserlich ist.
Ebenso erläuterte er, dass bei der Prüfung nicht nur die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes, sondern auch die Hygiene und sachgerechte Dekontamination wichtig ist. Mit diesen Ausführungen und einigen Hinweisen zu sachgerechter Beladung der Waschschleudermaschine und den Auswirkungen von Unter- und Überbeladung, der Wichtigkeit der Einhaltung der vorgegebenen Waschverfahren, etc. leitete Schäfer quasi schon zu dem nächsten Vortrag über, der sich ausschließlich mit sachgerechter Pflege bzw. den Folgen unsachgerechter Behandlung beschäftigt.
Individuelle Pflege erforderlich
"Feuerwehreinsatzbekleidung (PSA) muss entweder nach vorgeschriebenen Intervallen, nach dem Verschmutzungsgrad (allgemeine, biologische, chemische Verschmutzungen) individuell gesäubert, ausgerüstet (imprägniert), überprüft, repariert und/oder instandgesetzt werden", hieß es in einer der ersten Folien des Vortrages von Peter Schwarz, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Textilreinigerhandwerk.
Die individuelle Abstimmung der Pflegemethode ist das A und O, denn Feuerschutzbekleidung ist nicht grundsätzlich gleich Feuerschutzbekleidung. Auch in derselben Klasse der PSA und für vergleichbaren Einsatz konzipiert, gibt es eine Vielzahl von Unterschieden in der Bekleidung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Pflege haben: wie unterschiedliche Rohstoffzusammensetzungen, Oberflächen und Materialaufbauten.
Der Sinnersche Kreis und Anwendungstechnik
Eine Empfehlung für die sachgerechte Pflege der jeweiligen textilen PSA gibt der Hersteller über die Pflegesymbole und den Leitfaden zur Pflege in der Herstellerinformation.
In dem Zusammenhang erläutert Schwarz die Bedeutung der Symbole sowie den Wirkungsmechanismus bei der Pflegebehandlung, der durch den Sinnerschen Kreis dargestellt wird. Das Zusammenwirken von Mechanik, Zeit, Temperatur und Chemie beeinflusst das Waschergebnis bzw. hat Einfluss auf die PSA als solches während der Pflegebehandlung.
Dass die individuelle Abstimmung der Pflegemethode jedoch auch mit den Hinweisen, die vom Hersteller der Bekleidung gegeben werden, nicht ganz einfach ist, zeigen verschiedene Zusatzinformationen, die Schwarz gab. So sprach er beispielsweise von guter und schlechter Mechanik.
Er erläuterte in dem Zusammenhang, dass es sich bei Reibung um Mechanik handelt, die Faseraufrauhungen zur Folge haben kann. Reibung wird durch die Gestaltung der Trommel (lange und niedrige Trommeln erhöhen die Reibung) beeinflusst und kann auch durch lange Waschzeiten nochmals verstärkt werden. Reibung ist also als negative, schlechte Mechanik zu verstehen, während Stauchung eine positive Mechanik darstellt. Sie bewirkt eine Durchspülung, Walken und Ausdrücken und muss immer höher sein als die Reibung. Für die Durchspülung, einen guten Ausspüleffekt von Schmutz und Waschmittel wiederum ist eine ausreichende Menge Wasser erforderlich. Über die Pflegeempfehlung wird aber in der Regel keine Information zur Wassermenge gegeben.
Die Ausführungen des Sachverständigen zeigen deutlich, dass ein Anwendungstechniker zur sachgerechten Einstellung der Waschmaschinen, in denen die Feuerwehr-PSA gepflegt wird, hinzugezogen werden sollte. Professionelle Waschmaschinen sind individuell programmierbar, bieten also wesentlich mehr Abstimmungspotenzial in Bezug auf die einzelnen Parameter, je nach Warenart und Verschmutzung als Haushaltswaschmaschinen.
Kaputte PSA: Unsachgerechte Pflege oder Gebrauchsschäden?
Da es jedoch immer wieder zu Schäden an der PSA durch unsachgerechte Pflege kommt, ist es wichtig, diese von Gebrauchsschäden unterscheiden zu lernen, so Peter Schwarz. Beispielsweise kann wie erläutert, erhöhte Reibung im Pflegeprozess zu Faseraufrauhungen führen. Eine ähnliche Veränderung der textilen Oberfläche kann jedoch auch im Gebrauch entstehen. Das Ausmaß sowie die genaue Position der Aufrauhung ist in dem Fall zu untersuchen. Ist die gesamte Oberfläche beeinträchtigt, so liegt die Problematik vermutlich in der Pflege begründet. Sind die Aufrauhungen örtlich begrenzt, sind sie eher durch den Gebrauch entstanden, können jedoch auch durch das Hängenbleiben von Klettverschlüssen bei der Wäsche hervorgerufen worden sein.
Zum Pflegeprozess gehört auch die Trocknung. Durch diesen Prozess kommt es auch nicht selten zu Beschädigungen an der Bekleidung. So zeigte Schwarz beispielsweise durch einen Hitzestau im Trockner entstandene Beschädigungen an Reflexstreifen. Ein Hitzestau kann durch eine schlechte Luftführung, ein verschmutztes Flusensieb und insbesondere durch zu geringes Volumen des Trockners für die Wäschemenge bzw. Überladung entstehen.
Auch wurde über bestimmte Verschmutzungen gesprochen, die Schäden an der PSA hervorrufen können, sofern sie nicht sachgerecht entfernt werden. Schwarz merkte beispielsweise an, dass Löschschaum sofort zu entfernen sei, da seine Alkalität einen negativen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit von Reflexstreifen hat.
Viele weitere Beispiele wurden gegeben und auch noch ausgiebig über den Einsatz von Waschchemie, Imprägnierung sowie chemische Reinigung von Feuerwehr-PSA und Dekontaminierung durch eine Behandlung in flüssigem CO2 gesprochen.
Rettungsdienstbekleidung ist grundsätzlich infektionsverdächtig
Während es im Vortrag von Peter Schwarz in erster Linie um Feuerschutzbekleidung ging, führte Kai Wollwert, Geschäftsführer der GSG Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH, wichtige Punkte zum Thema Reinigung & Pflege von Rettungsdienst-PSA aus. Wollwert kommt zunächst auf das erste Thema des Tages zurück und weist auf die wichtigste rechtliche Grundlage hin: die DGUV Regel 105-03 "Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung im Rettungsdienst". Sie beschreibt, was Rettungsdienstbekleidung in Deutschland können muss, so Wollwert. Neben den bereits von Schäfer angesprochenen Pflichten, den grundlegenden und speziellen Anforderungen an PSA wird darin auch die Waschbarkeit und Desinfektion behandelt.
Die sachgerechte Aufbereitung von Rettungsdienst PSA kann nicht zu Dumpingpreisen durchgeführt werden.
Kai Wollwert
Wollwert berichtet aus seiner Erfahrung, dass - wie es schon im Vortrag von Peter Schwarz deutlich wurde - bei der Pflege von PSA andere Grundsätze gelten als beispielsweise bei Workwear ohne Schutzfunktion, Teambekleidung oder Flachwäsche. Das rechtliche Haftungsrisiko wird von den Wäschereien bzw. Wäschereileitungen oftmals sehr unterschätzt oder sogar ignoriert, so der Fachmann aus dem Bereich Rettungsdienstbekleidung.
Er bricht in dem Zusammenhang quasi eine Lanze für die professionellen Textilpflegebetriebe und appelliert an ein grundsätzliches Umdenken der Behörden, die Rettungsdienstbekleidung im Einsatz haben. "Die sachgerechte Aufbereitung von Rettungsdienst PSA kann nicht zu Dumpingpreisen durchgeführt werde", so seine Worte. Er bestätigt nochmals die Ausführungen von Schwarz, dass der Pflegeprozess individuell auf das Waschgut abgestimmt werden muss, sodass die zertifizierten Eigenschaften möglichst lange erhalten bleiben. Das gilt für Feuerschutzbekleidung ebenso wie für Rettungsdienstbekleidung.
Rettungsdienstbekleidung als infektionsverdächtige Wäsche

Wollwert weist zudem darauf hin, dass es sich bei Rettungsdienstbekleidung (im Gegensatz zu Feuerschutzbekleidung) aufgrund des Einsatzgebietes grundsätzlich um infektionsverdächtige Wäsche handelt.
Das setzt folglich voraus, dass Rettungsdienstbekleidung einer
desinfizierenden Industriewäsche nach ISO 15797 unterzogen werden können muss. Das entsprechende Verfahren wird durch das Prolabel in der PSA angegeben.
Besonders hebt Wollwert noch das Thema Warnschutz hervor. Gemäß der ISO 20471 wird der Warnschutz in drei Klassen aufgeteilt, die wiederum den Anteil der fluoreszierenden Fläche sowie den Anteil an retroreflektierendem Material festschreibt.
Je höher die Warnschutzklasse, desto größer der erforderliche Anteil. Die Funktionalität muss selbstverständlich über die gesamte Nutzung der PSA gewährleistet werden, was wiederum eine sachgerechte Pflege voraussetzt.
Warnschutz setzt Retroreflexion und Fluoreszenz voraus
Wie genau Retroreflexion funktioniert, erläutert Jürgen Zimmermann, Vertriebsmitarbeiter bei 3M, anschließend. 3M liefert einen überwiegenden Teil der retroreflektierenden Materialien für PSA. Dabei handelt es sich um Streifen, auf denen ca. 25.000 Glaskügelchen pro cm auf Aluminium bedampft sind. Dadurch wird erzeugt, dass das auftretende Licht eng gebündelt zur jeweils anleuchtenden Lichtquelle zurückgestrahlt wird. Wenn denn dann alles sachgerecht funktioniert.
Bereits von Schwarz wurde angesprochen, dass die Alkalität von Löschschaum die Funktionalität beispielsweise negativ beeinflussen kann. Der Aluminiumteil kann dadurch oxidieren, wird matt und reduziert die Rückstrahlkraft, erläutert Zimmermann noch mal näher. Auch stellt er dar, wie dies auf recht einfache Weise mit einer Taschenlampe und einer Vergleichskarte überprüft werden kann.
Die Funktionalität der Fluoreszenz ist jedoch weit schwieriger zu überprüfen, so Zimmermann. Die Prüfung kann nur im Labor durchgeführt werden. Ist die Fluoreszenz z.B. durch Vergrauung reduziert oder gänzlich verloren gegangen, hat dies genauso wie unzureichende Retroreflexion eine Aussonderung der PSA zur Folge. Dem werde jedoch häufig zu wenig Beachtung geschenkt, berichtet er.
Praxis: Schäden an PSA erkennen
Nach der Wissensvermittlung durch die Vorträge am ersten Tag, einem sogenannten Workingdinner beim Italiener, trafen sich die Teilnehmer am nächsten Tag wieder und durften ihre Kenntnisse anwenden. Die Veranstalter sowie die Referenten hatten einige Schadensfälle mitgebracht, die zu untersuchen waren.
Diverse Schäden wurden gefunden und darüber diskutiert, ob diese zu beheben sind oder die PSA auszusortieren ist.
So wurde an einer Feuerwehrjacke beispielsweise ein nicht funktionsfähiger Panik-Reißverschluss festgestellt, der jedoch unter Umständen mithilfe von Silikon wieder gangbar gemacht werden kann.
Auch wurden Schäden festgestellt, die unweigerlich zum Aussortieren führen, wie Beschädigungen an der Saugsperre bzw. der Membran oder Brandlöcher. Selbst kleinste Löcher sind problematisch, folglich ist eine sehr sorgfältige Überprüfung erforderlich.
Ebenso befanden sich unter den zu untersuchenden Teilen Artikel, die Flecken aufwiesen, über deren Entstehung diskutiert wurde.
Ein wichtiger Punkt war auch die Veränderung des Baumusters. Beispielsweise befand sich unter den Teilen eine Feuerwehrhose, bei der die Träger abgeschnitten waren. Sobald eine Änderung vorgenommen wurde, ändert sich die Haftung und überträgt sich auf denjenigen, der die Änderung vorgenommen hat.
Regelmäßige Prüfung der PSA ist Pflicht
Wieder bei rechtlichen Themen angekommen, wurde im Zusammenhang mit der Schadenssuche erneut explizit auf die Pflicht hingewiesen, dass eine regelmäßige Prüfung der PSA vorgeschrieben ist und diese nur durch Personen erfolgen darf, die vom Hersteller unterwiesen wurden. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber dafür Sorge trägt, dass die persönlichen Schutzausrüstungen während der gesamten Benutzungsdauer
gut funktionieren und sich in einem hygienisch einwandfreien Zustand befinden.
Die zwei Seminartage gingen wie im Fluge vorüber, die Teilnehmer wurden für Vieles im Zusammenhang mit der Verantwortung im Bereich der PSA-Nutzung bzw. Instandhaltung sensibilisiert, wenngleich auch längst nicht alle Fragen geklärt werden konnten. Sicher ist jedoch, dass ISPI mit der Veranstaltung ins Schwarze getroffen hat. Die Wissensvermittlung und ein fachlicher Austausch in derartiger Runde wurden sehr positiv aufgenommen. Die Veranstaltung war schnell ausgebucht und die nächste ist bereits in Planung.
Zum Verband: ISPI
ISPI Interessenverband für sachgerechte Pflege und Instandhaltung von PSA e.V. ist eine der führenden wissenschaftlichen Verbände rund um die Themen von kontaminierte PSA Bekleidung. Man will Experten-Know-how aus allen relevanten Bereichen vernetzen und Forschung und Weiterentwicklung von Verfahren und Abläufen vorantreiben.
ISPI ist die erste Anlaufstelle für alle Themen rund um professionelle Pflege, Instandsetzung und Dokumentation von Feuerwehr- und Rettungsdienstbekleidung. Ein Netzwerk aus anerkannten Prüfinstituten, Fachkräfte und Hersteller aus den jeweiligen Bereichen, sowie Endanwender aus Feuerwehren und Rettungsdiensten stehen im stetigen Austausch. Das bündelt Fachwissen mit dem laufenden Dialog.
Oberstes Ziel bei einer Wäsche muss es sein, eine saubere und auf deren Funktion hin geprüfte Persönliche Schutzausrüstung wieder in Umlauf zu bringen. Diese Anforderung ist nur mit zertifizierten und validierten Waschverfahren zu garantieren. Festgelegte standardisierte Abläufe vermeiden darüber hinaus eine Kontamination der Mitarbeiter in den jeweiligen Prozessen.
Wäschereien, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Zulieferer für die Bekleidungsindustrie, Labore und öffentliche Institute: Sie möchten ein Teil von ISPI werden?
Kontakt:
Telefon: +49 151 54 83 75 24