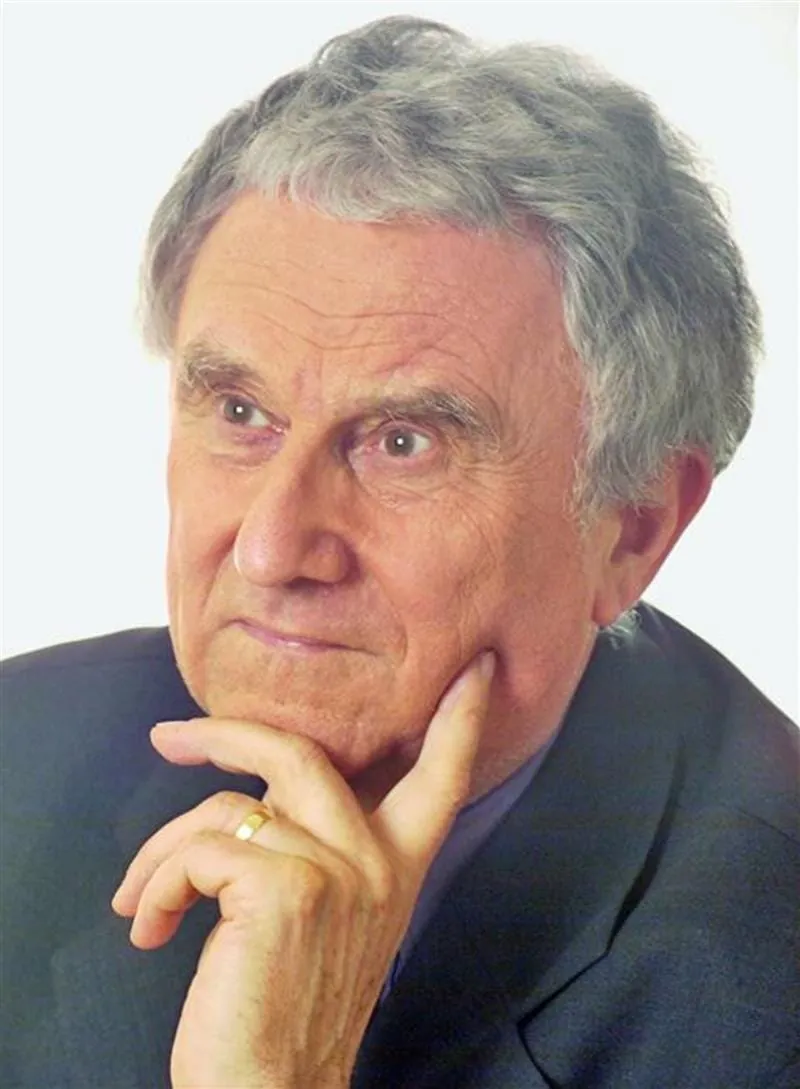Die internationale Konferenz Interclean fand am 7. und 8. März erstmals gemeinsam mit dem Verbandstag des Ostdeutschen Textilreinigungs-Verband e.V. in Eisenach statt. Mitveranstalter waren die Liga Oeconomica und der tschechische sowie ungarische Wäschereiverband.
Traumwäscherei greifbar nah
An zwei Tagen referierten in Eisenach Fachleute über einen effektiven Umgang mit Energie, um die Zukunft der Erde zu sichern und auch explodierenden Kosten im eigenen Betrieb entgegenzuwirken. Die zunehmende Automatisierung wirke sich nicht nur vorteilhaft auf Produktionsprozesse aus, stellte Lothar Kühne, Präsident der Liga Oeconomica und Vorstandsvorsitzender der europäischen Mittelstandsakademie, fest: „Die Mitarbeiter verlassen sich auf automatische Anordnungen und verlieren gleichzeitig an Wissen.“ Er unterstrich außerdem, dass die Fehlererkennung durch Sensortechnik immer mehr an Bedeutung zunehme.
Schon in zwei bis drei Jahren sei eine vollautomatisierte „Traumwäscherei“ zu haben, versicherte Kühne. Die Identifizierung der Ware sowie der Wasch- und Trockenprozesse seien bereits in allen Industriewäschereien automatisiert worden. In der Lagerhaltung sei die Automatisierung hingegen bisher kaum ein Thema. Ebenso sei der Anteil manueller Arbeit im Finishingbereich noch sehr hoch. Werde Berufskleidung automatisch kommissioniert, so erfolge dieser Prozess bei der Flachwäsche auch noch manuell. Auch gibt es in diesem Segment noch keine standardmäßige, durchgehende Auftragslogistik.
Für die vollautomatische Lagerhaltung schlug Kühne die Entwicklung selbstfahrender Rollcontainer vor. Softwareunterstützt könnten diese den Kundenanforderungen entsprechend die Wäsche für den nächsten Tag zusammenstellen. „Durch die Installation von rollenden Wänden könnte man das Lager so gestalten, dass es gleichzeitig für die Schmutz- und Sauberwäsche genutzt werden könnte“, so Kühnes Vision. Für den Bereich Finishing werde gegenwärtig an der Entwicklung eines Containersystems gearbeitet, das die Wäsche automatisch kommissioniert.
Eine weitere Variante sei die Verwendung von Sets. So könnten zum Beispiel Handtücher und andere Flachwäsche jeweils mit der dazugehörenden Berufskleidung hängend transportiert und abgehängt werden. „Denkbar sind solche Sets für Schiffskabinen, Ferienhäuser und kleine Pizzerien“, nannte Kühne nur einige Beispiele.
Über strukturelle Änderungen in den ungarischen Textilreinigungen berichtete Dr. Tibor Deme, der von 1984 bis Mitte der 90er Jahre Generaldirektor der größten Wäscherei Ungarns gewesen ist und heute mehrere Wäschereien in Ungarn besitzt. Vor 25 Jahren gab es in seinem Heimatland staatliche Betriebe und Hauswäschereien für Genossenschaften, Krankenhäuser, Militär und andere öffentliche Auftraggeber. Heute sind mehr als die Hälfte der großen Wäschereien privatisiert.
Die Kundenstruktur habe sich grundlegend geändert, erläuterte der Unternehmer. Das Auftragsvolumen aus dem Gesundheitswesen sei von 44 auf 60 Prozent gestiegen. Seien früher 30 Prozent der Aufträge Privatwäsche gewesen, sei dieses Segment heute mit einem Anteil von weniger als einem Prozent unbedeutend. Die Armee habe sich verkleinert und in der Industrie habe es ebenfalls gravierende Veränderungen gegeben. Infolge des Wettbewerbs stehe die Branche unter Preisdruck.
Eine Chance zum Überleben biete die langfristige Zusammenarbeit mit Kunden, die zwar niedrige Preise zahlen, aber sichere Auftraggeber seien.
Weitere Möglichkeiten seien Joint Ventures oder der Zukauf von Kapazitäten. „Einerseits sind die Preise gesunken, aber die Löhne und die Energiekosten steigen“, so Deme. Daher sei auch in Ungarn die Lebenssituation für Arbeitnehmer nicht einfach. „Der Bestand an Wäschereien wurde um mehr als die Hälfte reduziert“, beklagte der Referent die Entwicklung.
„Kraftquelle mit Janusgesicht: Die Arbeitskraft“ war das Thema einer Betrachtung von Dr. Tibor Erdèlyi. Der Generaldirektor der „Zentral Wäschereien“ mit Hauptsitz in Budapest konnte leider nicht persönlich an der Tagung in Eisenach teilnehmen, weswegen Christine Reichel, Mitarbeiterin des Tagungsbüros, seine Arbeit vortrug. Dabei wurden die 1960 von Douglas McGregor entwickelten Widersprüche zwischen zwei Theorien gegenübergestellt. Die Theorie X der „grundsätzlich faulen Angestellten, die kein Interesse an den Erwartungen der Organisation haben“, wurde der Behauptung, dass „die Angestellten ihre Arbeit im Prinzip gut erledigen möchten“ der Theorie Y gegenübergestellt. Der Feudalismus konserviere die Herrschaftsverhältnisse und eliminiere weitghend die Kommunikation zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, genauso wenig wie er den Wettbewerb toleriere. Dadurch blieben die Teilnehmer seelisch und moralisch unterernährt. Deshalb sei es für das Management angebracht, den Mitarbeiter auch seelisch zu stärken. Der Slogan seines Unternehmens verkünde die richtige Strategie, meint Erdèlyi in seinem Referat: „Glaube daran! Wisse es! Tue es!“
Zukunftsforscher Prof. Dr. Rolf Kreibich wagte eine Bestandsaufnahme der globalen Situation und schlug Lösungen vor. Während seiner Tätigkeiten als wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Berlin, als Direktor des Sekretariats für Zukunftsforschung in Gelsenkirchen und als Mitglied des Weltzukunftsrats stelle er immer wieder Defizite im globalen Denken und Handeln fest: „Wir profitieren zu wenig von der Globalisierung. Die Behauptung, Arbeit sei knapp, ist Unsinn. Wir sollten uns vielmehr langfristig und global orientieren.“ Wer vor 100 Jahren gelebt habe, würde den heutigen Entwicklungsstand als paradiesisch empfinden. „Aber aus heutiger Sicht ist die Zerstörung der Biosphäre ein Problem.“ Zentrale Schwierigkeiten seien der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt, die Süßwasserverknappung und –verschmutzung, die Verschmutzung der Weltmeere sowie der Anthroposphäre. Heute müssten wissenschaftliche Erkenntnisse als Produktivkraft eingesetzt werden. Seit 130 Jahren herrsche ein neues Muster der Weltentwicklung. „Wenn wir nicht in Unternehmen, im Bildungswesen, in Haushalten und auf allen anderen Ebenen Leitperspektiven für eine nachhaltige Entwicklung verfolgen, sind wir nicht zukunftsfähig“, mahnte der Zukunftsforscher.
Über wirkungsvolle Maßnahmen gegen Wärmeverluste in den Rohrleitungen referierte Joachim Krause, Vorsitzender des DTV-Ausschusses Technik und Umweltschutz. Allein die Wärmeabstrahlung eines ungedämmten 0,5-Zoll-Rohrs verursache jährlich große Verluste, unterstrich der Referent. Daher sollte der Unternehmer alles versuchen, um Energie effizient einzusetzen. Neben Maßnahmen zur Wassereinsparung und Energierückgewinnung könne zum Beispiel auch durch die Installation von Vorschaltgeräten beispielsweise an den Bügeleisen Strom eingespart werden. Auch trage eine vorbeugende Instandhaltung zur Dämpfung der Betriebskosten bei. „Die Maßnahmen sind bis zu 80 Prozent planbar und die Kosten überschaubar“, so Krause weiter. Die ereignisbetonte Instandhaltung sei hingegen nicht vorhersehbar und verursache zuweilen einen hohen Verlust an möglicher Kapazität sowie Mehrkosten durch Nacharbeiten. Darüber hinaus sei eine gute Organisation der Abläufe, des Personal- und Fahrzeugeinsatzes sowie der Kapazitäten Voraussetzung für eine wirtschaftliche Produktion.
Privatdozent Dr. Andreas Möckel von der Technischen Universität Ilmenau stellte neue Entwicklungen auf dem Gebiet energiereduzierter Antriebstechnik vor. Neue Rahmenbedingungen zögen eine neue Optimierung der Motorauslegung nach sich, unterstrich Möckel. Innovative Entwicklungen seien stets Kompromisse zwischen Variantenvielfalt und Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Thomas Schrank von der Versteegen-Assekuranz in Bonn sprach über das neue Umweltschadengesetz. Das USchadG ist seit dem 14. November 2007 mit Rückwirkung zum 30. April 2007 in Kraft. In dem Gesetzeswerk wird die Haftung für die Schädigung geschützter Arten und Lebensräume sowie von Gewässern und des Bodens geregelt. Die herkömmlichen Versicherungen decken die Sanierung von Umweltschäden öffentlich-rechtlichen Inhalts nicht ab. Daher wurde die Umweltschadenversicherung entwickelt. Das neue Produkt reguliert die Schädigung von Gewässern und Böden außerhalb des Betriebsgrundstücks. Grundwasserschäden sind indessen nicht inbegriffen. Je nach Standort und Risiko kann der Vertrag um zusätzliche Module erweitert werden.
Zum Thema „Mindestlöhne in Deutschland – Risiken für die Wäschereien“ konnte OTV-Geschäftsführer Steffan Rimbach keine erschöpfende Auskunft geben, weil zum Zeitpunkt der Tagung die Klärung der Voraussetzungen noch nicht abgeschlossen war. Fest steht aber: Sollten die Mitarbeiter mit Löhnen unterhalb eines gesetzlich festgelegten Minimums einverstanden sein, werden zumindest die Sozialbeiträge nach dem Mindestlohn berechnet.
In der Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Vorsitzender ist somit jetzt Hans-Albert Heim von der Wäscherei-Mietwäsche W. Heim oHG in Berlin, sein Stellvertreter wurde Friedrich Bauer von der Ba-Tex Textilpflege in Blankenhain. Rüdiger Wudtke von der Bestform Textilpflege GmbH in Berlin wurde das Amt des Schatzmeisters übertragen. Als Beisitzer wurden Henrik Bier von der Waschbär Mühlhausen GmbH, Albrecht Boden von der WSB Wäscheservice GmbH & Co. KG in Sebnitz sowie Bernd Grommelt vom Textilservice Grommelt in Greifswald und Bernd Haake von der Textilpflege GmbH & Wäscherei KG in Berlin gewählt. Eberhard Reichel hatte aus Altersgründen nicht mehr um den Vorsitz kandidiert und wurde von der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt.Reinhard Wylegalla